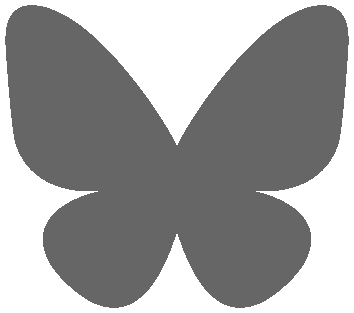Ursula Demitter aus Potsdam ist 67 Jahre alt, lebte und arbeitete in der DDR. Unter anderem bei der DEFA. Heute gibt sie Nachhilfeunterricht und schreibt hin und wieder ihre Erinnerungen von damals in Textdokumente. Da ich ohnehin ein großes Interesse an DDR-Biografien des Alltags habe und möchte, dass derartige Erinnerungen nicht auf irgendwelchen Festplatten verschimmeln und irgendwann einfach den Tod einer Festplatte sterben, packe ich die Texte von Ursula ab jetzt hier in unregelmäßigen Abständen rein. Hier finden sich alle ihrer Texte.

(Foto: Richard Peter, unter CC von Deutsche Fotothek)
Wir hatten in der Schule viele Angebote, uns nachmittags zu beschäftigen.
Da gab es zuallererst den Schulchor, geleitet von der Musiklehrerin, die ein enges Verhältnis zu den Schülern pflegte und die sehr verehrt wurde. Eine Gruppe auserwählter Schüler durfte sie sogar zu Hause besuchen. Ich gehörte nicht dazu, hatte irgendwie den Anschluss verpasst und war furchtbar neidisch. Später , als wir älter wurden, war ich froh, mit einer Lehrerin nicht so befreundet zu sein. Man konnte sich leichter von ihr abwenden.
In den unteren Klassen hatten wir in der Schule noch das Fach „Handarbeit“, oder hieß es „Nadelarbeit“? Es gab wohl beide Begriffe. Der Unterricht fand für die ganze Klasse statt, also auch für die Jungs. Später, so ab der sechsten Klasse, fiel das Fach weg. Ich glaube, die Lehrerin ging in Rente.
Es begann ganz harmlos mit ein paar Häkelmaschen und ein bisschen Stricken. Dann sollten wir einen Beutel stricken, damit wir das seitliche Maschenabnehmen, das man zum Strümpfestricken braucht, lernen konnten. Ich war in dem Fach nicht begabt, denn meine Motorik hielt sich in Grenzen. Obwohl auch bei uns zu Hause unter Omas Anleitung hauptsächlich das Stricken hochgehalten wurde, hatte ich im Handarbeitsunterricht keine Chance. Wenn wir Hausaufgaben bekamen, strikte meine Oma immer heimlich ein Stück an meinem Beutel. Leider sahen ihre Maschen viel gerader und gleichmäßiger aus als meine und so blieb der Lehrerin die Schummelei nicht verborgen.
Irgendwann nähten wir eine Schürze und begannen sie zu besticken. Ich hatte mich für eine Halbschürze aus weißer Baumwolle entschieden. Am unteren Rand sollte eine Kreuzstichkante in Braun, Rot und Grün entstehen. Bis zur Mitte bin ich tatsächlich gekommen. Noch Jahre danach mahnte mich das unvollendete Stück vorwurfsvoll an meine Unfähigkeit zu feiner Handarbeit. Irgendwo bei den angefangenen Näharbeiten, die in dieser Zeit fast jeder Haushalt besaß, denn man konnte um Himmels willen, ein Stück Stoff nicht einfach wegwerfen, lag meine halb gestickte Schürze.
Warum ich später freiwillig in die Arbeitsgemeinschaft Handarbeit gegangen bin, ist mir bis heute ein Rätsel. Na schön, die Lehrerin war sehr nett. Es ging auf den Herbst und es machte nicht mehr so viel Spaß, sich draußen herumzutreiben, weil es schnell dunkel wurde. In der Arbeitsgemeinschaft trafen wir uns einmal wöchentlich für ca. 2 Stunden in einem Klassenzimmer im kleinen Schulhaus. Jegliches Material wurde uns gestellt. Die Lehrerin arbeitete wahrscheinlich ehrenamtlich. Aber genau weiß ich es nicht. Als erstes stellten wir Untersetzer für Kaffekannen her. Eine dicke Paketstrippe wurde umhäkelt und gleichzeitig zusammengefasst. Immer eine Masche umhäkeln und eine Masche zum verbinden mit der vorherigen Runde. Das Garn war billig und ließ sich schlecht verarbeiten. Es hatte keinerlei Spannung. Auch die Farben waren sonderbar: Wir hatten nur Lila, Grün und Grau zur Verfügung.
Nach dem einige Kannenuntersetzer tatsächlich entstanden waren, machten wir uns an einen runden Behälter mit Deckel. Es sollte eine Art Schmuckkästchen werden. Meines wurde tatsächlich fertig, es war halt ein langer Winter. Wenn wir vom Handarbeitskurs nach Hause gingen, war es schon dunkel. Zusammen mit meiner Schulkameradin Regina musste ich vom Dorf Drewitz zum Stern, die endlose Sternstraße entlang laufen. Am Ende der Sternstraße wohnte Regina in einem der letzten Häuser. Dann musste ich allein noch ein Stück unbebauten Feldweg am Kiefernwald entlang, bis ich unsere Straße erreichte, die beleuchtet war und in der ich mich sicher fühlte. Einmal verfolgte uns ein Radfahrer, der sich seinen Pullover über den Kopf gezogen hatte. Wir begannen zu rennen. Plötzlich fuhr er mitten zwischen uns hindurch und rief: Huhu. Wir rannten jeder in eine Richtung wie um unser Leben. Keine drehte sich nach der anderen um. Zu Hause schämte ich mich dann, dass ich jede Art von Solidarität hatte vermissen lassen. Aufgeregt schilderte ich den Vorfall und konnte die Person sehr genau beschreiben. Auch einen Sack mit Grünfutter auf dem Gepäckständer hatte ich gesehen. Meine Schwester wusste sofort, wer aus ihrer Klasse jeden Abend Karnickelfutter holen musste. Es war Kalle. Am nächsten Tag suchte meine Mutter die Familie auf, Kalle wurde befragt, überführt und bekam von seiner Mutter zwei schallende Ohrfeigen. Der Fall war erledigt, die Untat gesühnt. Trotzdem machte ich von da an um Kalle immer einen großen Bogen.
In der siebenten Klasse wurde uns mitgeteilt, dass in Potsdam eine Station Junger Techniker eröffnet worden sei. Wir bekamen Hinweise auf verschiedene Arbeitsgemeinschaften, unter anderem Fotografie. In unserer Familie wurde das Fotografieren immer wichtig genommen. Zu unzähligen Anlässen mussten wir drei Geschwister uns aufstellen, lächeln, „nicht bewegen“, rief meine Mutter, bis sie das Bild im Kasten hatte. Es waren immer die gleichen gestellten Szenen, nie war ein Schnappschuss darunter. Dennoch war meine Mutter auf ihre Kamera Marke Voigtländer mit ausziehbarem Lederbalgen unendlich stolz. Sie hatte sie sich als junges Mädchen von einem der ersten Gehälter gekauft.
Eine Gruppe von acht oder zehn Mädchen aus beiden siebenten Klassen meldete sich zum Fotoclub. Wir fuhren immer mit dem Fahrrad bis zur Schlaatzstraße. In der Friedhofsgasse in einer Villa aus gelben Klinkern war der Club. Die Fotoarbeitsgemeinschaft hatte ihr Domizil im Souterrain. Dort lernten wir nicht nur Fotografieren sondern auch den ganzen labortechnischen Ablauf: Negativentwicklung in der Entwicklerdose, Film aufhängen, trocknen lassen. Dann mittels Vergrößerungsgerät Positive herstellen und mit Plasteklammern in die drei bekannten Schalen werfen: Entwickler, Wasser, Fixierbad. Wir waren eine sehr fröhliche Arbeitsgemeinschaft bestehend aus Mädchen der zwei siebenten Parallelklassen. Ich erinnere mich, dass ich verwundert war, dass manche Mädchen, die in der Schule so absolute Schlusslichter waren, so nett und lustig sein konnten. Das heißt, wir waren in unserer bisherigen Freizeit in recht sortierte Gruppen geteilt. Ich unterschied in der Schule zwischen den „Guten“, die meine Freunde waren und den „Doofen“, mit denen es nicht lohnte, sich zu befassen. Die Teilnahme in der AG sowie das ganze fototechnische Material, das wir nach und nach vernichteten, kostete uns keinen Pfennig. Wir durften soviel Bilder wie wir wollten anfertigen und mit nach Hause nehmen. Auf unsere eigenen Porträts waren wir immer besonders scharf. Die Foto AG hat mir später geholfen, eine Lehrstelle zu bekommen. Als ich mich nach der zehnten Klasse im DEFA-Spielfilmstudio um die Ausbildung als Filmkopierfacharbeiter bewarb wurde ich gefragt, warum gerade etwas mit Film. Da konnte ich natürlich vom Leder ziehen und in den wärmsten Farben meine Begeisterung fürs Fototechnische Fach schon seit der siebenten Klasse schildern. Das saß. Ich hatte den Job.
Zu Schuljahresbeginn waren wir in der Drewitzer Schule plötzlich zwei siebente Klassen geworden und das kam so. Die Enklave Steinstücken, die zu Westberlin gehörte war bis ca. Mitte der Fünfziger Jahre noch nicht eingezäunt. Es standen einfach nur Schilder da. Man wusste, die eine Straßenseite war Westen und die andere war Osten. Rund um Steinstücken patrouillierten DDR-Grenzpolizisten in Doppelstreife, voll bewaffnet. Ein kleine Grundschule, die sogenannte „Waldschule“ grenzte so nah an Steinstücken, dass man aus dem Fenster in den Westen hätte springen können. Das war natürlich Unsinn, denn man konnte sowieso dorthin ungehindert laufen. Jedoch wurde die Schule geschlossen, die Schüler auf umliegende Schulen verteilt und das Gebäude abgerissen. Diese, irgendwie doch schon vorbereitenden Maßnahmen wurden knapp drei Jahre vor dem Mauerbau getroffen.
Auf der Westseite der Steinstraße gab es einen kleinen Tante Emma-Laden. Von Klassenkameraden habe ich damals gehört, dass sie im Westladen eingekauft hatten. Sie warteten, bis die Grenzposten auf ihrer Runde außer Sichtweite waren und flitzen dann auf die andere Straßenseite . Mit ein paar Westgroschen von Oma wurde Kaugummi gekauft, der nicht nur wunderbar duftete, sondern in jedem der flachen Päckchen, wenig größer als eine Streichholzschachtel, lag ein farbiges Schauspielerfoto einer Hollywoodberühmtheit. Viele von uns sammelsten und tauschten die Bilder. Meine Schwester besaß einen Campingbeutel aus braunem Kord aus dem Westen. An der Seite war ein Täschchen aus durchsichtiger Plaste mit einem Druckknopf. Aus diesem Plastesfenster lächelte vom Kaugummibildchen Harry Bellafontee. Ich hatte keinen Campingbeutel und ich liebte Harry Bellafonte von Anfang an. Gleich nach der Wende sah ich ihn das erste Mal leibhaftig im Konzert im ICC. Er wurde von einem Damenbackround begleitet, damit man nicht merken sollte, dass er die großen Höhen nicht mehr packte. „Harry,“ dachte ich, „wir haben zu lange gewartet“.
Ich hätte mich nie getraut, in Steinstücken einkaufen zu gehen, denn es war „politisch“ und streng verboten. Außerdem hatte ich kein Westgeld zu meiner eigenen Verfügung.
Einmal kam meine Schwester von der Tanzstunde. Weil es schon spät war und sie sich graulte lief sie auf der Westseite entlang, denn die hatten schließlich Laternen. Zwei junge Grenzer hielten sie auf und verlangten, sie solle auf der Ostseite laufen. Sie wollten ihr Angst machen, kraft ihrer Wassersuppe als Grenzorgane. Aber meine Schwester durchschaute das Geschehen und blieb stur. Sie zeigte keinen Ausweis und gab keine Auskunft wo sie herkam und ging auch nicht auf die Ostseite. Sie fand die beiden Jungs einfach frech. Das Ganze endete mit einem Telfonanruf bei uns zu Hause. Spät abends musste sich mein Vater ins Auto setzen um meine Schwester auszulösen. Die Sache hatte kein Nachspiel. Niemand fand etwas dabei. Auch kann ich mich nicht erinnern, dass meine Eltern meiner Schwester Vorwürfe gemacht hätten. Es war halt dumm gelaufen. Eine Plänkelei unter jungen Leuten.
Später, noch vor der Mauer, wurde ein Zaun um Steinstücken gebaut und die Bevölkerung bekam einen Korridor durch den sie nach West-Berlin fahren konnten. Er wurde auf halber Strecke von DDR-Grenzern kontrolliert. Die Mauer, die den Korridor vom Osten trennte, sah schon genau so aus, wie später die Berliner Mauer. Als die Mauer stand, habe ich davon gehört, dass ein amerikanischer Hubschrauber in Steinstücken gelandet sei. Es war eine Provokation gegen die DDR hieß es und man könne froh sein, dass die Russen nicht geschossen haben. Der Laden hatte dann auch schon dicht gemacht.










 14 Kommentare
14 Kommentare