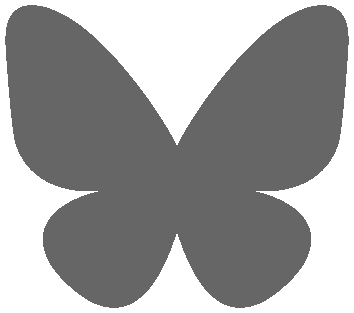Ursula Demitter aus Potsdam ist 67 Jahre alt, lebte und arbeitete in der DDR. Unter anderem bei der DEFA. Heute gibt sie Nachhilfeunterricht und schreibt hin und wieder ihre Erinnerungen von damals in Textdokumente. Da ich ohnehin ein großes Interesse an DDR-Biografien des Alltags habe und möchte, dass derartige Erinnerungen nicht auf irgendwelchen Festplatten verschimmeln und irgendwann einfach den Tod einer Festplatte sterben, packe ich die Texte von Ursula ab jetzt hier in unregelmäßigen Abständen rein. Hier finden sich alle ihrer Texte.

(Foto: Richard Peter, unter CC von Deutsche Fotothek)
Wir waren also wirklich aus der Stadtmitte an den Stadtrand gezogen. Drewitz war damals noch ein eigenständiges Bauerndorf mit den dafür typischen Strukturen und gehörte noch nicht zur Stadt Potsdam. Es gab ein paar Großbauernhöfe. Noch hatte die Zwangskolletivierung zu Genossenschaften nicht stattgefunden. Dazu die kleine Infrastruktur: Es gab einen Schuster, zwei Bäcker, einen Fleischer, einen Fahrradfritzen, einen Gärtner, einen Frisör, zwei Kneipen, einen Taxifahrer, eine Drogerie und einen kleinen Wäscheladen. Dann noch eine Tischlerwerkstatt , einen Kohlenhändler und den Dorfpolizisten. Natürlich die Schule mit dem kleinen und dem großen Schulhaus und die Kirche, wo jeden Sonntag der Gottesdienst stattfand. Und es gab auch schon den gerade erst neu eingerichteten Konsum. Nach Potsdam fuhr man mit dem Oberleitungsbus über den Bahnhof Drewitz bis zum Rathaus Babelsberg. Von dort mit der Straßenbahn weiter. Die Endhaltestelle des Busses mit dem Wartehäuschen war Treffpunkt für Heranwachsende. Es zog halt die Jugendlichen zur Bushaltestelle, wie die „kleinen Italiener“ zum Bahnhof. (Ein erfolgreicher deutscher Schlager, gesungen von Conny Frohboes in den sechziger Jahren. Kennt heute keiner mehr)
Wir waren Zugezogene, gehörten noch nicht dazu und wurden kritisch beäugt. Aber da wir drei Kinder waren, hatten wir in drei Altersstufen Klassenkameraden, die jede mögliche Neuigkeit über unsere Familie im Dorf verbreiteten.
In Drewitz sprach man irgendwie ein anderes Idiom als in Potsdam. Die Umgangssprache beharrte unerschütterlich auf einer sehr abgespeckten Grammatik. Mich irritierte das zuerst, weil in meiner Familie mehr oder weniger Hochdeutsch, auf alle Fälle aber grammatikalisch richtig gesprochen wurde.
Die Drewitzer hatten es mit dem Maskulin: „Der Radio spielt, der Moped fährt und der Benzin stinkt.“ Das war gängiger Alltag. Am schönsten fand ich einen Zuruf einer Frau für die Fahrschüler nach Schulschluss: „Fährt ihr mit den Bus? Brauchta nich su rennen, der Bus fahrt schon.“
In der neuen Schule war alles anders. Schon dass wir zwei Schulhäuser hatten und dass Jungen und Mädchen in einer Klasse lernten, war für mich neu. Auch wusste ich nicht, dass es eine nette Geste der Aufmerksamkeit war, wenn die Jungen die Mädchen schubsten oder am Zopf zogen. Also ging ich als Kämpfer für Gerechtigkeit dazwischen und bekam ein paar Mal eine aufs Maul, bis ich begriffen hatte, dass es besser war, sich nicht einzumischen. Als Neuankömmling in der zweiten Klasse gehörte ich natürlich in das kleine Schulhaus. Das war ein uraltes Gebäude aus Glindower Klinkern, direkt gegenüber der Kirche. Wir Kleineren hatten einen eigenen Schulhof, der durch einen Zaun vom „großen Schulhof“ getrennt war. Die Pforte war immer offen, damit die Lehrer ungehindert von einem Haus zum anderen wechseln konnten. Aber nie kam es einem der Zwerge in den Sinn, sich auf dem großen Schulhof blicken zu lassen. Auch die älteren Schüler achteten das Verbot, unseren Schulhof zu betreten… War es Disziplin oder Autorität der Lehrer oder Angst vor Strafen? Wer weiß das schon. Jedenfalls war es eine gute Regelung. Gleich in den ersten Tagen meiner Anwesenheit zog die ganz Klasse direkt nach dem Unterricht durch das Dorf. „Zum Religion“ sagten die Kinder. Nur das einzige katholische Mädchen unserer Klasse durfte nicht mit, wofür sie mir sehr leid tat. Ich lief einfach mit, denn als Jüngste in der Familie war ich es gewohnt, mich anzuschließen, ohne zu verstehen, was ablief.
In einem ausgebauten Stallgebäude, an der Kreuzung Neuendorfer zur Trebbiner Straße fand unser Religionsunterricht statt. Offiziell hieß es „Christenlehre“, wie unsere Schwester Ida, die den Unterricht erteilte, immer wieder verbesserte. Schwester Ida war eine evangelische Diakonisse, deren Hände immer wie frisch gescheuert aussahen und nach Kernseife rochen. Sie las uns jedesmal einen Abschnitt aus einer Kinderbibel vor. Das Buch hieß „Das Wort läuft“ und enthielt die biblischen Geschichten in etwas verständlicherer Sprache. Es wurde auch gesungen und gebetet und der ganze Ablauf gefiel mir sehr. Zu Beginn der Stunde sollte sich immer ein Kind melden und die Geschichte von der letzen Woche nacherzählen. Ich erzählte und erzählte, wann immer ich konnte. Die anderen Kinder fanden es nicht so toll wenn sie drankamen und ließen mir den Vortritt. Jedesmal bekam ich bunte Bildchen über biblische Themen, die von einem großen Bogen wie Briefmarken abgerissen wurden.
Eines Tages , als Schwester Ida wieder die Anwesenheit prüfte, kam heraus, dass ich nicht auf ihrer Liste stand. Ich sagte meiner Mutter, „Du muss mich zum Religion anmelden, ich bin noch nicht auf der Liste.“ Das brachte einiges Durcheinander in unsere Familie. Es stellte sich heraus, dass wir alle drei nicht getauft waren und dass sich meine Eltern zu diesem Problem nie ausgetauscht hatten. Ich verlangte kategorisch, sofort getauft zu werden, was nach einigem Hin und her auch tatsächlich stattfand. Eine Taufe musste natürlich im Gottesdienst stattfinden, aber wegen des zu erwartenden Geredes im Dorf legte der Pastor die Taufe kurzerhand in den Kindergottesdienst. Es gab auch zu Hause eine schöne Feier, viele entfernte Verwandte kamen und brachten Geschenke. Plötzlich hatte ich „Patentanten“. Ich fand, dass es sich gelohnt hatte. Um unseren gerade erworbenen Glauben vor dem Dorf zu demonstrieren gingen wir nun jeden Sonntag in die Kirche. Mein Vater kam nur zu Weihnachten mit, sagte aber nie ein Wort dagegen.
Unsere Lehrer in der Schule waren anders, als in der alten Schule in Potsdam. Sie waren sehr nett, nicht so sehr auf Autorität bedacht und es herrschte eine familiäre Atmosphäre. Im Winter durften alle Kinder, die einen weiten Schulweg hatten Hausschuhe mitbringen und sich an den Ofen setzen. Viele Lehrer waren sogenannte „Neulehrer“ von denen meine Mutter immer ein wenig herablassend sprach. Aber sie konnten interessante Geschichten aus ihren früheren Berufen erzählen. Das forderten wir immer am ersten und letzen Schultag ein. Nur der Mathelehrer, der schon ziemlich alt war, las uns an solchen Tagen Balladen vor. Ich fand dass „Der Taucher“ oder „Der Handschuh“ von Schiller ungeheuer spannende Geschichten waren. Unsere Musiklehrerin war auf Volkslieder versessen. Was sollte sie auch machen, die neuen Pionierlieder waren nicht ihr Geschmack. So lernten wir der „Mond ist aufgegangen“ und „Kein schöner Land in dieser Zeit“ und vieles mehr. Die Lieder kannte ich alle schon von zu Hause und wurde schnell ihr Liebling. Bei Auftritten unseres Schulchores musste ich in der ersten Reihe stehen und immer den Anfang der nächsten Strophe leise soufflieren. In den neuen Liederbüchern standen die meisten Lieder verkürzt. Es fehlten immer die Strophen in denen der liebe Gott vorkam. Unsere Lehrerin ließ uns jedes Mal die fehlende Strophe ins Heft schreiben und wir sangen sie mit.
Mein Klassenlehrer in der Unterstufe war früher zur See gefahren und benutze noch das entsprechende Vokabular. „Wenn ich sage ausscheiden, dann ist ausscheiden.“ rief er oft, um uns zur Ruhe zu bringen. Später erfuhr, ich dass dies ein Kommando auf See ist. Einmal schrieb er ein Wort falsch an die Tafel. Ich begann mit ihm zu streiten, aber er blieb dabei. Als ich mich zu Hause bei meiner Mutter beschwerte, drückte sie mir einen Duden in die Hand. Damit marschierte ich am nächsten Tag in die Schule. Wenn ich daran denke, ist es mir heute noch peinlich.
In dem frühen DEFA-Spielfilm „Die besten Jahre“ gibt es eine ähnliche Szene.
Da beschwert sich einer über das mangelnde Wissen des Neulehrers beim Landrat.
„Solange wir nicht genug ausgebildete Lehrer haben“ sagt ihm der ganz ruhig, „wird Blume eben mit h geschrieben.“
Außer der katholischen Anna waren alle Kinder in meiner Klasse Pioniere. Sie besaßen ein blaues Halstuch und einmal in der Woche war Pioniernachmittag. Da durfte ich nicht mitmachen. Es war klar, das ich nicht dazugehörte. Sie machten Wanderungen in die umliegenden Nuthewiesen, sammelten Eicheln und Kastanien für die Waldtiere im Winter und bastelten. Da die Klassenlehrerin, den Pioniernachmittag gestaltete, wurde auch in den folgenden Tagen im Unterricht darüber gesprochen. Immer wenn der Pioniernachmittag begann und ich nach Hause geschickt wurde, war ich sauer. Zu Hause begann ich zu verhandeln. Von meiner Mutter kam nur Ablehnung, aber keine Begründung, kein Argument. In der Schule wurde ich mehrmals gefragt, wann ich denn nun eintreten wolle. Bis es mir zu viel wurde mit der Fragerei und ich sagte: „Nächste Woche“. Ich wurde noch gefragt, ob meine Mutter Bescheid wüsste, was ich eifrig bejahte. Es gab auch kein Schriftstück an meine Eltern. Ich wurde feierlich aufgenommen und bekam das ersehnte blaue Tuch. Vorsichtshalber versteckte ich es noch ein paar Wochen, war dann aber so ungeschickt, dass es irgendwann herauskam. Meine Mutter war beleidigt und ich wusste nicht warum.
Mit den Pioniernachmittagen fuhren wir auch manchmal in die Stadt. Wir lernten das funkelnagelneue Pionierhaus am Heiligen See kennen. Dort sahen wir Filme und Theaterstücke oder wurden zum Basteln angeleitet. Einmal mussten alle Schüler der kleinen Schule in eine Klasse kommen. Der Raum war völlig überfüllt. Dann wurde uns gesagt, dass ein großes Unglück geschehen ist, der Genosse Stalin ist gestorben. Einige größere Mädchen begannen zu weinen. Dann sollten wir eine Schweigeminute halten, was nicht recht gelang. Ich blickte an die Klassenwand. Dort waren vier Köpfe im Profil aneinadergefügt aus Presspappe und mit Goldbronze lackiert. Sogar ich wusste, wer das war: Marx, Engels, Lenin, Stalin.
Ganz andere auch sehr schöne Erlebnisse organisierte die Kirche. Es gab Spielnachmittage im Garten des Pfarrers mit Kaffe und Kuchen, es wurde ein großes Erntefest gefeiert, zu dem wir Kinder Blumenbögen für die Fuhrwerke binden durften. Zu Weihnachten übten wir ein Krippenspiel ein, bei dem ich immer mitspielen durfte. Zum Kindertag spannten die Bauern Fuhrwerke an, die mit Bänken bestückt waren. Wir fuhren ins Nachbardorf und wurden dort mit Spielen beschäftigt und mit Streuselkuchen versorgt.
Die größten Feste fanden im „Lindenhof“ statt. Sie waren mal von der Schule und mal von der Kirche ausgerichtet. Zu Weihnachten spielten wir ein Märchen von der Schule und zu Ostern eins von der Kirche. Auch Fasching wurde gefeiert, was uns Kindern großen Spaß machte.
Um an diesen Feiern teilzunehmen musste man immer ein bis zwei Briketts, eingewickelt in eine Zeitung mitbringen. Damit wurde ein eiserner Ofen gefüttert, der den Saal heizen sollte. Mit den Jahren wurden die kirchlichen Aktivitäten weniger. Inzwischen war eine LPG gegründet und etliche Bauern die nicht einverstanden waren, nach dem Westen gegangen.